Optimierung der pharmakologischen Überleitung von Palliativpatient*innen von stationär nach ambulant
Sowohl in Deutschland als auch international wünschen sich viele Patient*innen mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen, dass ihnen eine Versorgung und ein Sterben im häuslichen Umfeld ermöglicht wird. Vor diesem Hintergrund besteht in Deutschland ein Anspruch auf eine ambulante Palliativversorgung, die sich in einen allgemeinen, überwiegend hausärztlich getragenen Teil (AAPV) und eine spezialisierte Palliativversorgung (SAPV) gliedert. Trotz dieser Angebote erleben über 80 Prozent der Patient*innen innerhalb ihres letzten Lebensjahres mindestens einen Krankenhausaufenthalt, über 50 Prozent versterben im Krankenhaus. Für die Zukunft ist es daher von großer Bedeutung, dass nach einem Krankenhausaufenthalt eine funktionierende ambulante Weiterversorgung – insbesondere auch im Hinblick auf die Arzneimittelversorgung – gewährleistet ist. Ziel des Projektes ist die lückenlose Sicherstellung der Medikamenteneinnahme auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.
Finanzierungsstatus
Das Projekt ist dank Unterstützung der Schober-Stiftung erfolgreich finanziert. Weitere Spendenprojekte der Stiftung Universitätsmedizin Münster finden Sie hier.

Prof. Dr. med. Philipp Lenz
Geschäftsführer WTZ Netzwerkpartner Münster
Ärztliche Leitung UKM-Palliativmedizin
Kontakt
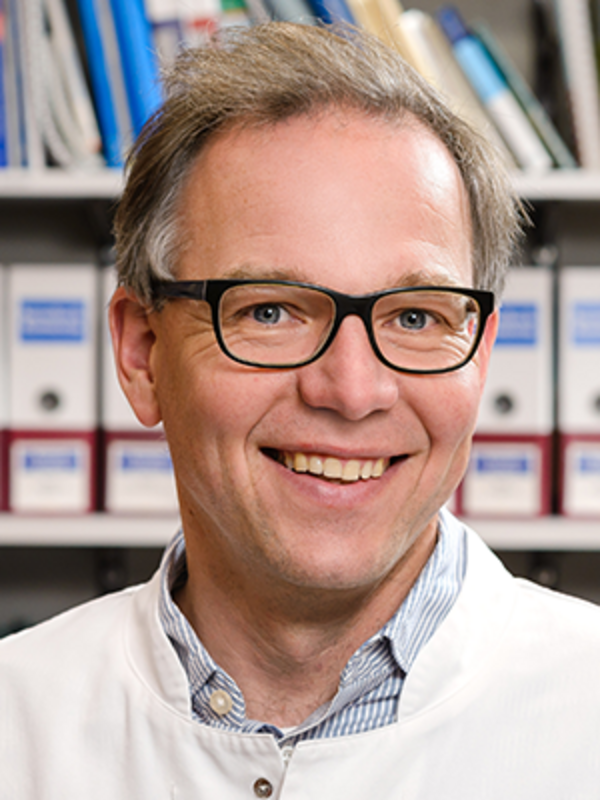
Ziele des Projekts
Medikamentöse Therapieansätze sind eine entscheidende Säule in der Symptomkontrolle von Paliativpatient*innen: Daher ist es wichtig, dass die Versorgung mit Medikamenten nicht nur während der stationären Behandlung, sondern auch nach Entlassung in der häuslichen Umgebung optimal funktioniert. Um den Entlassprozess vom stationären Setting am UKM hin zur spezialisierten ambulanten Versorgung (SAPV) zu optimieren, soll in dem Projekt "Optimierung der pharmakologischen Überleitung von Palliativpatient*innen von stationär nach ambulant (EntMedPall)“ eine Stationsapothekerin die Entlassmedikation von Palliativpatient*innen bereits vor der Entlassung auf mögliche Fehlerquellen und Probleme prüfen. Damit sollen vermeidbare stationäre Wiederaufnahmen, die Verschlechterung von Symptomen zu Hause und auch die Prozessbedingungen für alle Beteiligten (Patient*innen, Angehörige, Hausärzt*innen, ambulante Palliativmediziner*innen etc.) vermieden bzw. verbessert werden.
