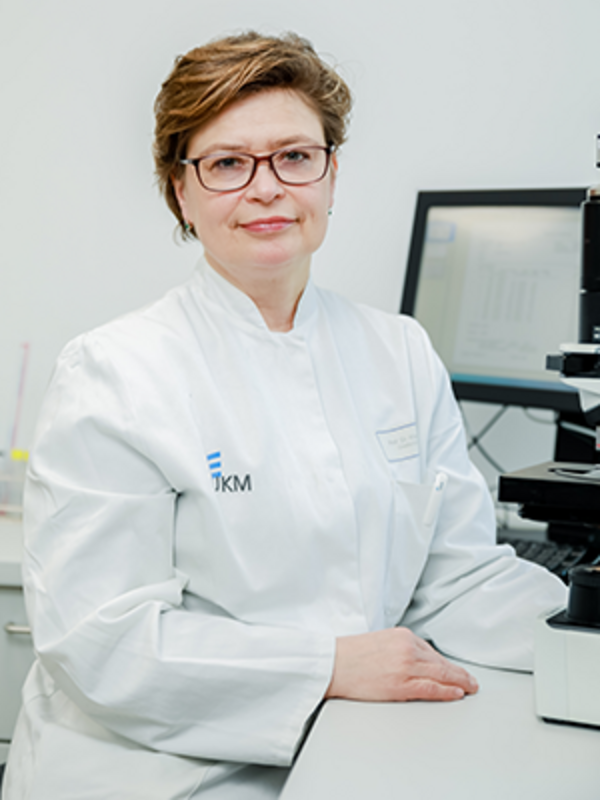FertiTOX: Fruchtbarkeit bewahren trotz belastender Therapien
Viele onkologische Therapien, die Leben retten, haben leider eine Schattenseite: Sie können die Fruchtbarkeit von Patient*innen erheblich beeinträchtigen. Das Projekt FertiTOX dokumentiert erstmals systematisch die Auswirkungen solcher Therapien auf die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen – ein wichtiger Schritt, um Betroffenen in der Zukunft bessere Perspektiven zu bieten.
Im Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA) tragen wir entscheidend zu diesem innovativen Vorhaben bei. Unsere Abteilung für Klinische und Operative Andrologie betreut jährlich etwa 520 Kryokonservierungen von Ejakulatspermien und testikulären Spermien und zählt damit zu den führenden Zentren in Deutschland. Die Fertilitätsprotektion auf weiblicher Seite erfolgt über unser Kinderwunschzentrum (Fertiprotekt®).
FertiTOX ist ein Gemeinschaftsprojekt von über 30 reproduktionsmedizinischen Zentren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Daten, die hier erhoben werden, sind für die zukünftige Betreuung und Therapieplanung der Patient*innen von großem Wert.
Finanzierungsstatus
Die Finanzierung des Projekts ist dank erster Spenden bereits angelaufen. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre finanzielle Unterstützung. Weitere Spendenprojekte der Stiftung Universitätsmedizin Münster finden Sie hier.
FertiTOX-Studie: Hoffnung für Krebspatient*innen mit Kinderwunsch
Ziele des Projekts
FertiTOX ist ein gemeinsames Projekt von über 30 reproduktionsmedizinischen Zentren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Daten, die hier erhoben werden, sind einzigartig und von hohem Wert für die zukünftige Betreuung und Therapieplanung von Patient*innen.
Unsere Ziele:
- Erhebung von Basisdaten: Wir dokumentieren Fruchtbarkeitsbefunde aus Kryokonservierungen von Ejakulat und Hodengewebe sowie anamnestische Informationen.
- Therapieverlauf und Nachsorge: Die durchgeführten onkologischen Therapien und deren Auswirkungen werden über Jahre hinweg erfasst.
- Langfristige Perspektiven: Nachuntersuchungen nach 1,5 und 10 Jahren ermöglichen eine fundierte Langzeitbewertung.